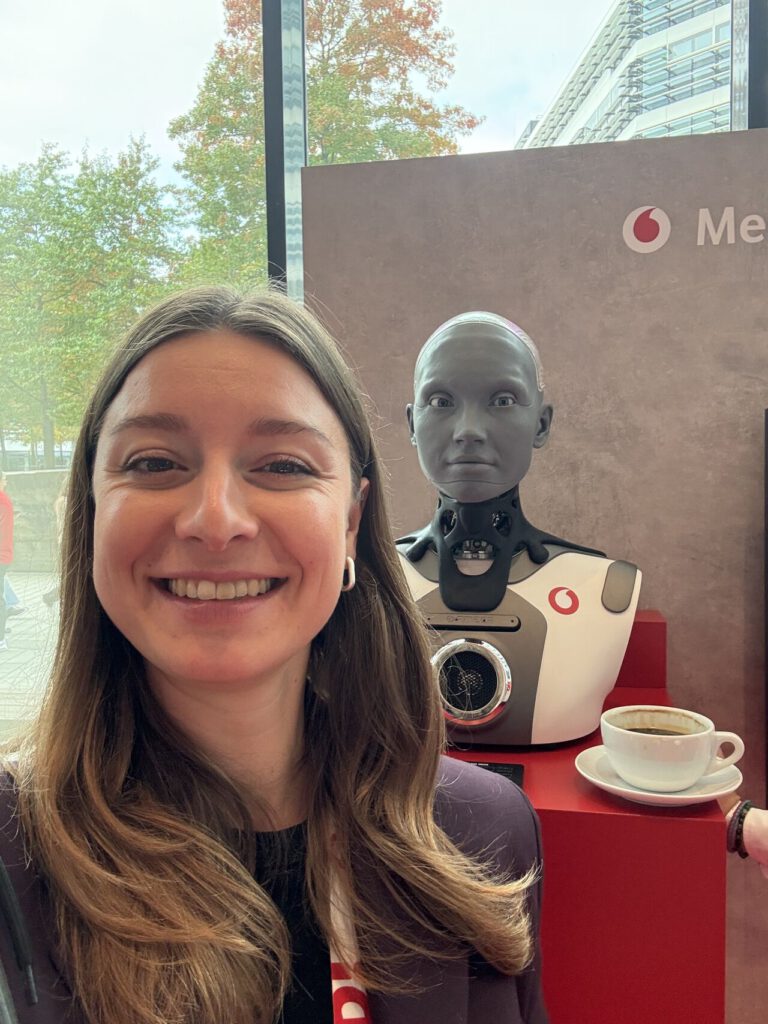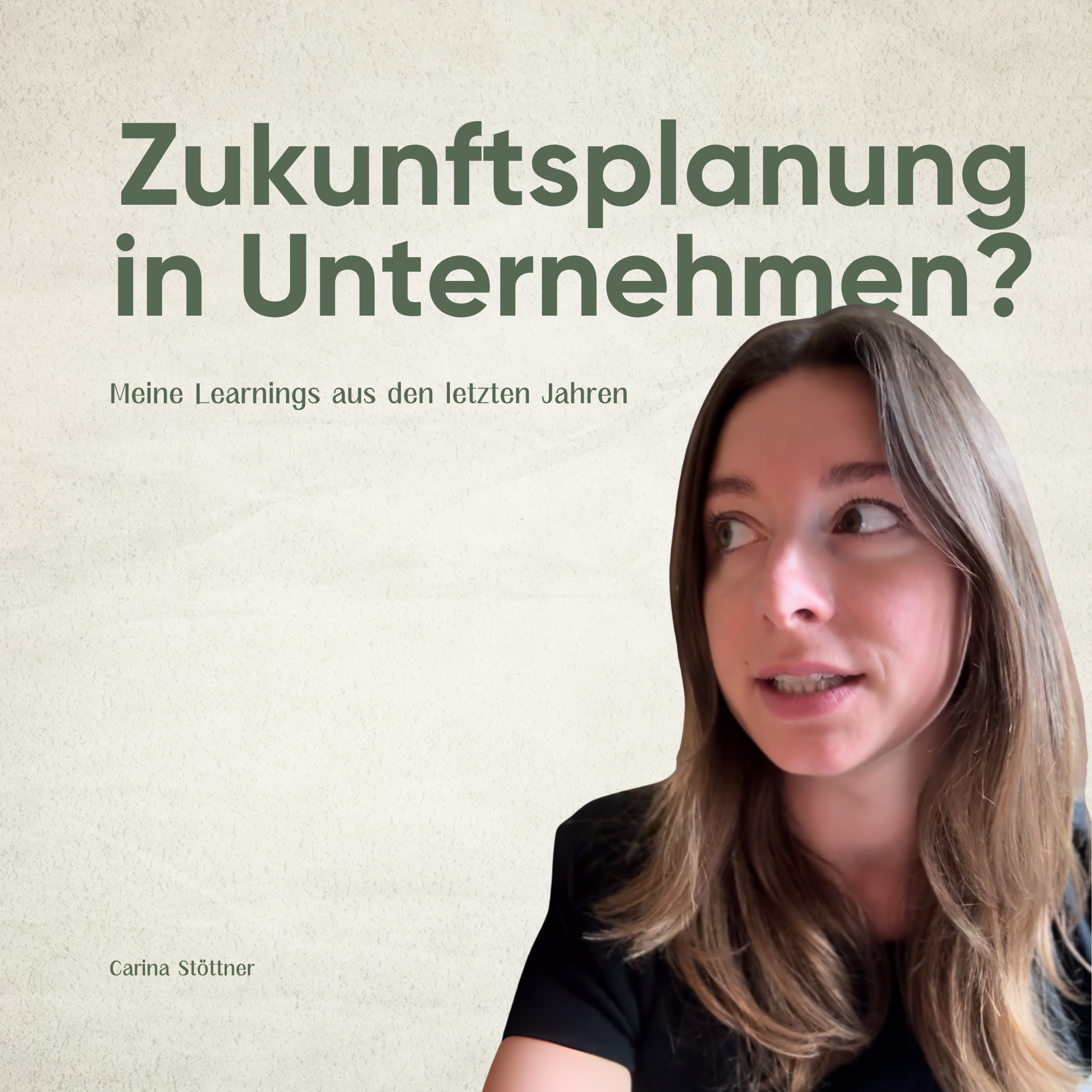Chancen für die Industrie: Carina Stöttner im Audi-Forum in Neckarsulm
Am 1. Dezember 2025 war Carina Stöttner zu Gast beim Weihnachtsempfang von Südwestmetall Heilbronn im Audi-Forum Neckarsulm. In ihrem Impuls sprach sie über die Zukunft der deutschen Industrie – über Chancen inmitten der Transformation ebenso wie über die Herausforderungen, die auf Unternehmen und Gesellschaft zukommen. Kommunikationsberater Christian Gleichauf hat den Abend im Anschluss pointiert zusammengefasst – seine Einordnung bildet die Grundlage des folgenden Beitrags.
Deep Tech ist das Thema, um das wir uns kümmern sollten. Das macht Carina Stöttner sehr deutlich. Und das hat auch ein klein wenig mit Heilbronn zu tun.
Die Zukunftsforscherin hat beim Weihnachtsempfang von Südwestmetall im Audi-Forum gestern Abend einige Zukünfte umrissen, die zu denken geben.
In drei von vier Szenarien werden die Bäume in Europa nicht mehr in den Himmel wachsen. Nur wenn wir es schaffen, unsere Stärken zu stärken und ein paar „bahnbrechende Innovationen“ loszutreten, haben wir eine Zukunft, auf die wir uns freuen können.
Dazu braucht es eine gesellschaftsweite Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen. Lebenslanges Lernen, ein neues Wissenschaftsverständnis, ein neues Selbstverständnis der Industrie, kurz: Transformation.
Am Ende dürfte es auch ein Mix aus verschiedenen Szenarien sein. Der bekannte Ansatz Local for Local wird wohl auf jeden Fall eine Rolle spielen. Man muss allerdings auch hoffen, dass Szenarien, die eine Verzwergung der deutschen und europäischen Wirtschaft zur Folge haben würde, nicht Wirklichkeit werden.
Carina Stöttner gelingt es jedenfalls, innerhalb weniger Minuten die Brisanz deutlich zu machen – vor einem Publikum, das sich eigentlich ständig mit Transformation auseinandersetzt.
Christine Grotz, Vorstandschefin der Bezirksgruppe Heilbronn/Region Franken – Südwestmetall, fragt zu Recht: „Was können wir tun?“ Carina Stöttner redet den Arbeitgeber-Vertretern ins Gewissen: „Die Industrie unterschätzt ihren Hebel.“ Es brauche beispielsweise Grundlagenforschung, und für die wird wohl nicht der Staat in vollem Umfang sorgen. Und es braucht Kooperationen.
Die ehemalige Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch wünscht sich neue Wege in der Ausbildung. Vor den mehr als 160 geladenen Gästen legt Heiko Asum von Fibro Rundtische in Weinsberg den Finger in die Wunde: „Wir sind nicht mehr schnell genug.“
Deeptech, Zusammenarbeit von Industrie und Wissenschaft, die Kombination des „Out of the box“-Denkens eines Daniel Düsentrieb mit der Geschäftstüchtigkeit eines Dagobert Duck, der Einsatz von Robotern, um Produktion auch in Europa zu halten, der klare Fokus auf Zukunftstechnologien wie KI, Chipproduktion und Quantencomputing. Was bei diesen Zutaten auffällt: Das meiste davon entsteht derzeit im Ökosystem Heilbronn oder aus diesem heraus (Schwarz Gruppe!).
Wir sehen also, wie eine Blaupause für Europa entsteht. Und wenn das unsere einzige Chance ist, nicht unterzugehen, dann klingt das so, als müsste es eine Mehrheit geben, die bei diesem Versuch zumindest mitzieht.
Klingt das nicht nach Weihnachtsbotschaft?
Erwähnenswert noch das originelle Begrüßungsvideo von Senta Woldeck und Güldeniz Acar (wo war nur Jörg Ernstberger? 😉). Und nicht zu vergessen: Der Preis Herz der Wirtschaft ging in diesem Jahr in den Main-Tauber-Kreis an die Futurelabs gGmbH. Eine Initiative, die den Experimentiergeist der Jugend anregt, praktische Umsetzung ermöglicht. Passt zum Thema des Abends.
Geben wir Deep Tech eine Chance?
Dieser Beitrag wurde von Christian Gleichauf auf LinkedIn veröffentlicht. Christian ist im schnell wachsenden Ökosystem Heilbronn bestens vernetzt. Er berät Unternehmen und Institutionen in der Kommunikation und bringt dabei seine journalistische Expertise ein (mehr auf seiner Seite www.wortCraft.de).