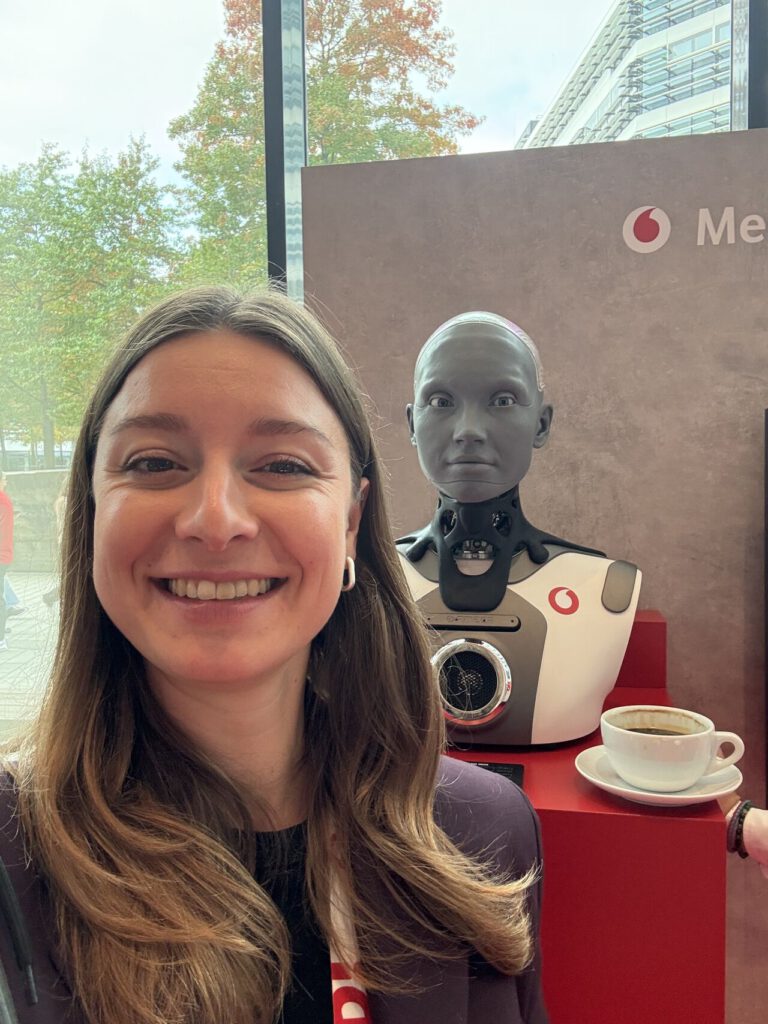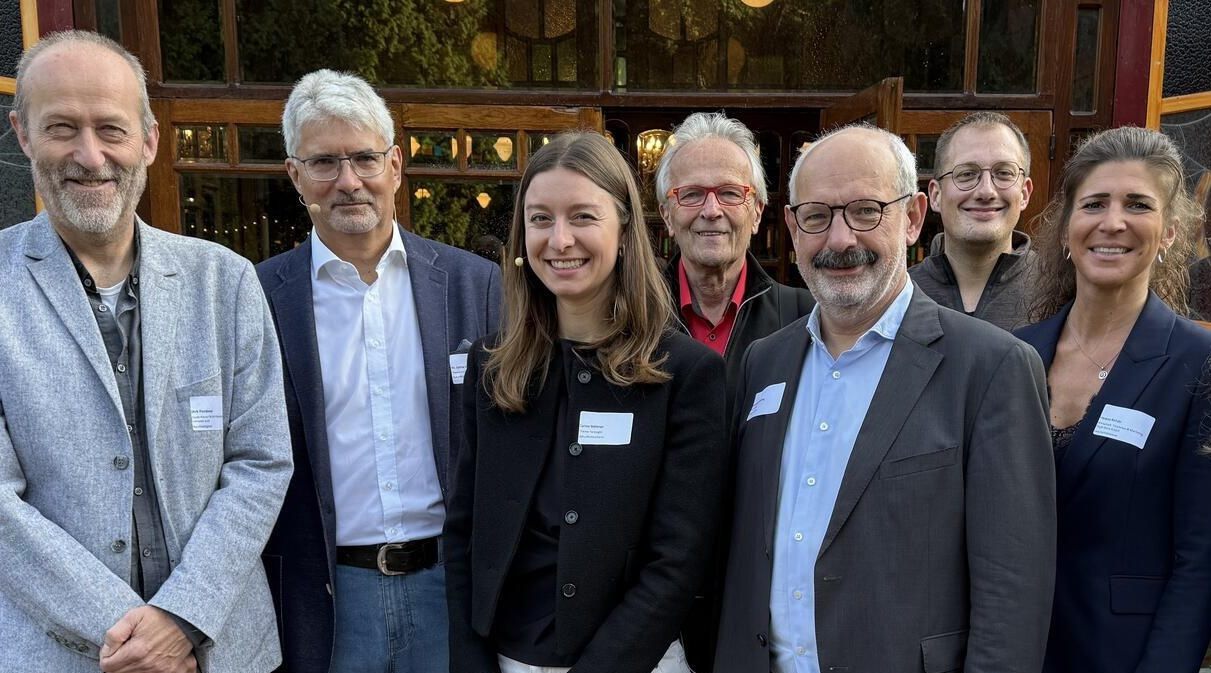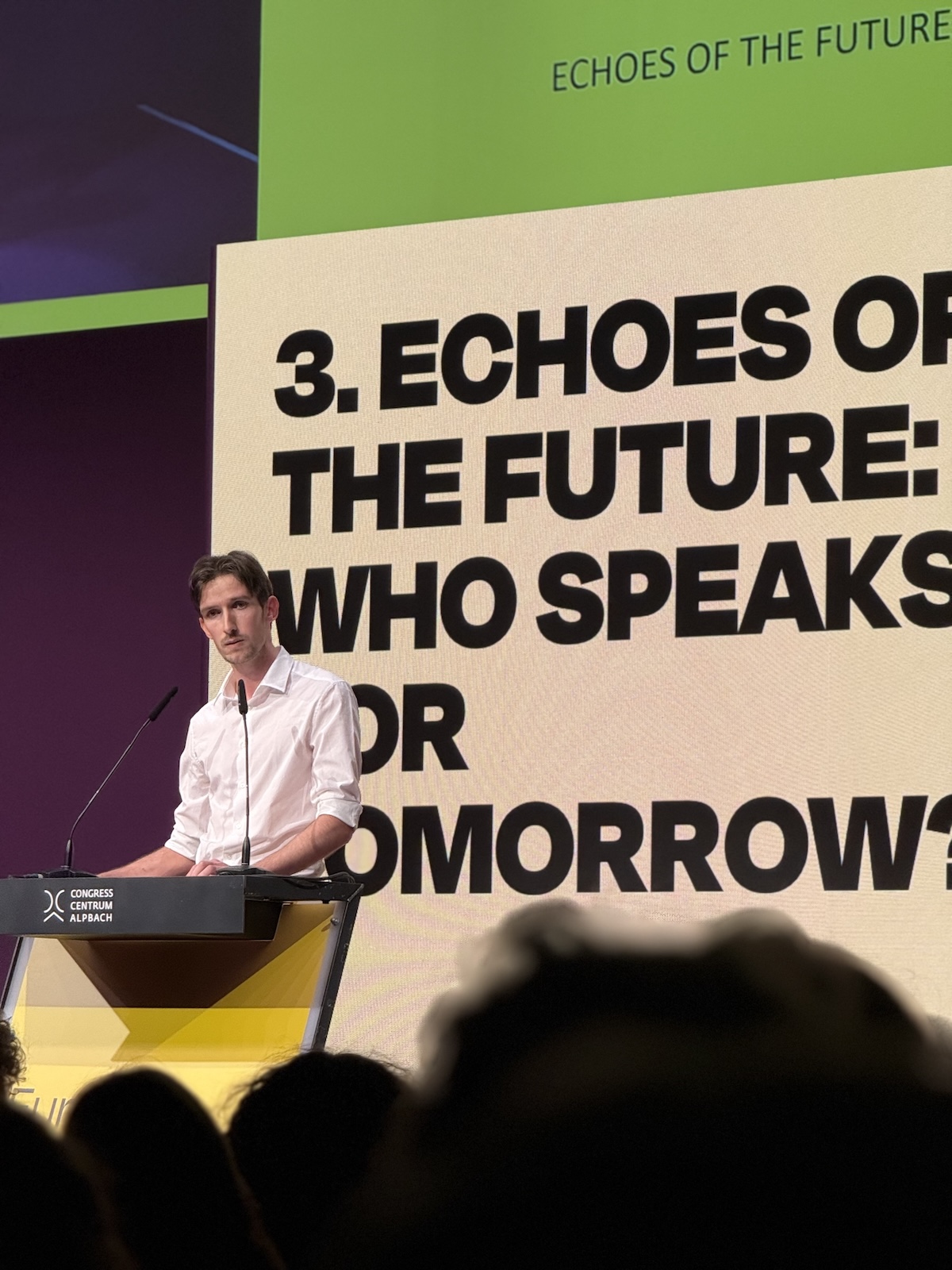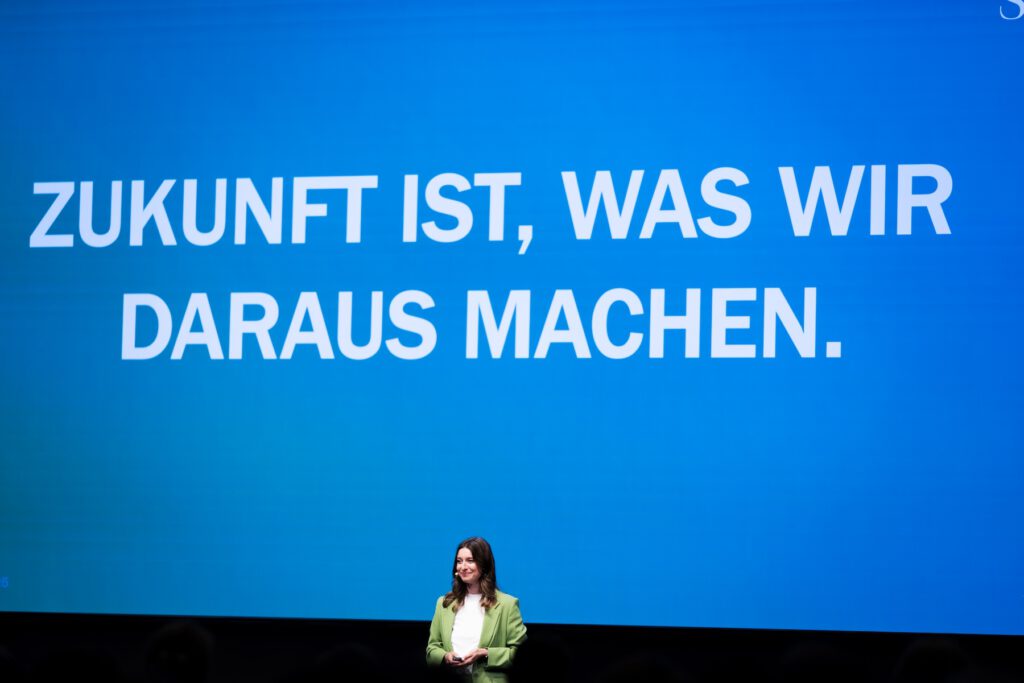Wenn Nobelpreisträger, Kanzlerkandidaten, Außenministerinnen, Ministerpräsidenten, Tech-Leader, EU-Botschafter und führende Wissenschaftlerinnen zusammenkommen und buchstäblich gemeinsam auf Wanderschaft gehen, um miteinander zu sprechen, dann ist man wohl in Alpbach gelandet.
Das European Forum Alpbach (EFA) gilt als eine Art „europäisches Davos“ mit starkem Fokus auf Demokratie, Gesellschaft und die Rolle Europas in der Welt. Seit 1945 ist das kleine Tiroler Alpendorf einmal im Jahr ein Treffpunkt für Menschen, die Zukunft gestalten: Entscheidungsträger:innen, Vordenker:innen, junge Talente. Unter dem Motto „Recharge Europe“ stand 2025 die Frage im Mittelpunkt, wie Europa in Zeiten multipler Krisen wieder Energie und Orientierungskraft entwickeln kann.
Ich war dieses Jahr erstmals dabei und wollte bewusst einmal aus meiner klassischen Wirtschafts-Bubble in die EU- und Zivilgesellschafts-Bubble springen. Denn welche politischen Rahmenbedingungen gerade im Hintergrund verhandelt werden und welche gesellschaftlichen Zukunftsfragen dort diskutiert werden, ist letztlich auch für die Zukunft von Unternehmen und Wirtschaft hochrelevant.
Ein schönes Zitat aus einem Image-Film als Auftakt zu einer der Diskussionsrunden:
„Dieser Kontinent ist nicht auf Selbstzweifel gegründet. Er besteht aus Menschen mit Mut, Solidarität und dem Willen, ihre Stimme zu erheben.“
Othmar Karas, Präsident des Europäischen Forums Alpbach sagt, wir müssen uns in Perspektivenvielfalt üben:
„Jemand anderes kann genauso recht haben wie ich. Der Schlüssel liegt darin, Kompromisse zu finden.“
Meine Sessions & Eindrücke
Mainstreaming von Extremismus: Wo ist die rote Linie für die Demokratie?
Auf einer Wanderung diskutierte ich mit u. a. Armin Laschet, Carl Bildt, Julia Ebner und Peter Neumann über die Gefahren, wenn extremistische Narrative in den gesellschaftlichen Mainstream einsickern. Wie robust sind unsere Demokratien noch und wo verlaufen die roten Linien, die wir schützen müssen? Besonders eindrücklich war, wie nah politische Praxis und wissenschaftliche Analyse hier zusammengebracht wurden und das nicht im Konferenzsaal, sondern beim Gehen durch die Berge.
“Changing democracy is a hidden process. We need to secure our democratic structures davor, von Rechtspopulisten niedergeschlagen zu werden.” – Armin Laschet, former Minister President of North Rhine-Westphalia & Member of the German Bundestag
Vereint oder losgelöst? Der Kampf um Europas Identität und Zukunft
Mit Martin Selmayr, Helmut Brandstätter, Edit Inotai und Josephine van Zeben ging es um die zentrale Frage: Wie definiert sich Europa in einer Welt, die immer fragmentierter wirkt? Spannend war vor allem, wie unterschiedlich politische, mediale und akademische Perspektiven die Herausforderungen, aber auch die Chancen für die europäische Identität beleuchteten.
„Externe Kräfte, China, Russland, die USA, tragen zur Anheizung von Extremismus bei. Doch damit er verfängt, müssen in der Gesellschaft bereits Bruchlinien vorhanden sein: eine Bankenkrise, Migrationsdruck oder ähnliche Schwachstellen.“ – Carl Bildt, ehemaliger Ministerpräsident von Schweden
In einem Gespräch während der Wanderung mit Martin Selmayr, EU-Botschafter Rom; ehemaliger Generalsekretär der Europäischen Kommission, über die Ukraine sagte er folgendes:
„Die Herausforderung für eine Gesellschaft und ein System besteht nicht nur darin, von Frieden zu Krieg zu gehen, sondern auch darin, als Nation vom Krieg wieder in den Frieden zurückzukehren.“
Auch sagt er:
„Ich bin fest überzeugt: In nur wenigen Jahren werden wir mehr als 30 Mitgliedstaaten haben.“ und bezieht sich dabei auch auf die Ukraine als neues Mitglied.
Dr. Julia Ebner, Senior Research Fellow & Leiterin des Violent Extremism Lab am Institute for Strategic Dialogue (ISD), University of Oxford, die lange tief in die extremistische Szene eingetaucht ist, meinte:
„Vertrauen verlagert sich von Institutionen hin zu einzelnen Personen, häufig zu Influencern, anstatt in etablierte Organisationen.“ Diese Dynamik sollten wir uns zu Nutze machen.
Josephine van Zeben, Professorin für transnationales Recht; Prorektor für Bildung und akademische Personalentwicklung, European University Institute sagt:
„Wir sprechen ständig über die Probleme, die die EU lösen muss. Aber wir fragen uns selten: Wie sieht Erfolg für die EU eigentlich aus?“
Der strategische Aufbruch Europas: Sicherheit in einer fragmentierten Welt
In einer Zeit, in der geopolitische Risiken zunehmen, wurde hier diskutiert, wie Europa seine Sicherheitspolitik neu denken muss. Mit Katarzyna Pisarska, Sarah Wheaton, Peter Wagner, Robert Brieger und Meredith Whittaker wurde klar: Sicherheit bedeutet heute nicht mehr nur militärische Stärke, sondern auch digitale Souveränität, Resilienz gegen Desinformation und strategische Handlungsfähigkeit im globalen Kontext. Meredith Whittaker, Präsidentin der Signal Foundation sagt:
„Wir müssen in Technologien investieren, die Unabhängigkeit von anderen Staaten ermöglichen und die Monopole der großen Tech-Konzerne herausfordern.“
Sunrise Hike auf die Gratlspitze
Eines meiner „Off topic“ Highlights: Um 4 Uhr morgens startete die Wanderung hinauf auf die Gratlspitze. Inmitten des Sonnenaufgangs über den Alpen entstanden Gespräche, die man in einem Konferenzsaal wohl nie so führen könnte. Für mich ein Format, das inspiriert – Lernen und Austauschen in Bewegung.
Europe in the World – Abschlussdebatte
Zum Abschluss der Europe in the World Days beim European Forum Alpbach 2025 wurde klar: Die alte regelbasierte Ordnung, in der Europa florierte, existiert nicht mehr. „The order in which Europe was thriving is a thing of the past, and it will not come back. Nostalgia is not a strategy,“ betonte Sabine Weyand (Europäische Kommission). Während die USA sich zunehmend aus multilateralen Strukturen zurückziehen, sieht Arancha González Laya (Sciences Po) die Gefahr, dass Europa in eine „vierte Phase“ abrutscht: „The fourth stage of Europe’s evolution could be that we… become somebody else’s colony.“
Die Panelist:innen waren sich einig, dass Europa nur durch tiefere Integration und neue Partnerschaften Stärke gewinnen kann. Shashi Tharoor (Indisches Parlament) fragte provokant: „Can Europe and India be a pole to ourselves and constitute an alternative to both the US and China?“ Andreas Treichl (ERSTE Foundation) warnte hingegen vor Europas Wehrlosigkeit: „We don’t fight with each other, but we let others kill us. This is a major change and we have no means to counter it.“ Für Nobelpreisträger Joseph Stiglitz liegt die Chance Europas in Regulierung und Wettbewerbspolitik: „If Trump says to Europe: Give up your competition policy or face 50% tariffs – what will Europe do?“ Klar wurde: Europa muss seinen Binnenmarkt vollenden, Innovation skalierbar machen und Allianzen ausbauen, sonst bleibt es Spielball einer härteren, multipolaren Welt.